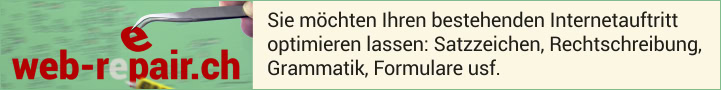Im Kampf um das Leben ihrer Tochter hat die Mutter der todkranken Pippa (5) eine weitere gerichtliche Niederlage erlitten. Das Berufungsgericht in London bestätigte die vorherige Entscheidung des High Courts, dass die lebensverlängernden Maßnahmen bei dem Mädchen beendet werden sollten.
Er sei ebenfalls der Meinung, dass es «in Pippas bestem Interesse sei, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden», schrieb der Berufungsrichter in einem schriftlichen Urteil. Die 41-jährige Mutter kündigte an, bis vor das höchste Gericht Großbritanniens, den Supreme Court, ziehen zu wollen.
Die fünfjährige Pippa liegt seit rund zwei Jahren mit schweren Hirnschäden in einem Londoner Krankenhaus. Im Januar 2019 erkrankte das Mädchen – eine Grippeerkrankung führte zu schweren Schäden im Gehirn, einer sogenannten akuten nekrotisierenden Enzephalopathie. Die Ärzte haben keine Hoffnung mehr und wollen die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden, die Mutter wehrt sich jedoch gerichtlich dagegen. In der Urteilsbegründung vom High Court im Januar hieß es, der Fall sei «herzzerreißend». Allerdings könne Pippa ihre Umwelt oder Interaktionen mit anderen Menschen nicht wahrnehmen. Eine Verlegung nach Hause mit speziellen Geräten, wie sie die Mutter gefordert hatte, sei daher nicht sinnvoll.
«Ich bin nach dem Urteil des Berufungsgerichts heute erneut am Boden zerstört», sagte Pippas Mutter, die den Rechtsstreit noch immer nicht aufgeben will. Sie will zumindest eine Testphase durchsetzen, in der ihre Tochter mit mobilen Geräten zuhause gepflegt werden kann. Sie ist überzeugt, dass es Pippa in der heimischen Umgebung besser gehen könne als im Krankenhaus.
Die Anti-Abtreibungs-Organisation Society for the Protection of Unborn Children hatte die Rechtskosten für die Anwälte der 41-jähriger Mutter übernommen. Das Urteil sei «eine Entscheidung, die es der Verzweiflung ermöglicht, über die Hoffnung zu triumphieren», sagte der Chef der Organisation John Deighan. Das Gericht habe entschieden, dass der Lebenskampf der kleinen Pippa in den vergangenen zwei Jahren «umsonst» gewesen sei.
Der Fall ähnelt anderen Fällen in Großbritannien: Der kleine Charlie Gard starb im Alter von elf Monaten ebenso Alfie Evans, der nur 23 Monate alt wurde. Beide Jungen hatten einen seltenen Gen-Defekt. In beiden Fällen schaltete sich sogar der Papst ein, um die britische Justiz dazu zu bringen, einer Behandlung im Ausland zuzustimmen – allerdings vergebens.
Nach Ansicht von deutschen Medizinern sind Entscheidungen wie diese in der Bundesrepublik kaum vorstellbar. «Die Ärzte – und auch die Richter – in Großbritannien nehmen für sich in Anspruch, dass sie besser entscheiden können, was für das Wohl des Kindes am besten ist», sagte Nikolaus Haas, Leiter der Abteilung für Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Universitätsklinikum München, während des Verfahrens rund um den Fall Pippa. «Dieses Denkmuster ist für uns in Deutschland nicht vorstellbar. Wir haben gelernt, mit schwer behinderten Patienten anders umzugehen.»
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.